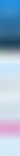Geldpolitik: Orphanides schlägt Taylor
26.03.2019

Markus Richert, CFP® und Seniorberater Vermögensverwaltung bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln / Foto: © Portfolio Concept
Mehr als zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise herrscht geldpolitisch noch immer Ausnahmezustand in Europa. Der Nullzins scheint zementiert und eine Änderung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, auch 2020 - so vermuten so manche Beobachter - wird sich an der Geldpolitik der EZB wenig ändern. Viele sehen in EZB-Präsident Mario Draghi den Schuldigen für die derzeitige Politik. Dabei ist er nur das Gesicht einer Politik, die strengen Regeln unterworfen ist.
Solche Regeln schreiben Zentralbanken kein bestimmtes Handeln vor, sondern sie versuchen, das Handeln von Zentralbanken anhand bestimmter Kriterien zu beschreiben. In den vergangenen zwei Jahrzehnten galt dabei die Taylor-Regel als das Maß aller Dinge. Benannt wurde sie nach ihrem Begründer, dem US-Ökonomen John B. Taylor. An der von Taylor entwickelten Formel lässt sich erkennen, wie ausgelastet eine Volkswirtschaft ist. Besonders zwei Komponenten bestimmen diese Formel. Die Inflation und die wirtschaftliche Aktivität einer Volkswirtschaft. Letztere wird in der Regel über den Arbeitsmarkt abgebildet. Die Formel vergleicht einfach den Soll- mit dem Ist-Zustand. Aus der jeweiligen Differenz, zum einen der Differenz von Inflationsziel und bestehender Inflation (Inflationslücke) und der Differenz aus natürlicher Arbeitslosenrate abzüglich aktueller Quote (Output-Lücke) wird dann der optimale Leitzins abgeleitet.
Geldpolitik im Autopiloten-Modus
Bis zur Finanzkrise ließ sich die europäische Geldpolitik gut mit der Taylor-Regel nachvollziehen. Im Zuge der Finanzkrise ließ jedoch der Wirkungsgrad der Formel nach. Denn die Situation der einzelnen Mitgliedsstaaten in der Eurozone ist seitdem nicht mehr so homogen wie vor der Krise. Vor allem beim Wirtschaftswachstum, der Arbeitslosenquote und der Inflation unterscheiden sich manche Staaten der Währungsunion erheblich. Für Deutschland müsste demnach der optimale Zinssatz bei 3,8 Prozent liegen, für Griechenland dagegen bei minus 6,4 Prozent. Für alle anderen Staaten liegt der optimale Zins irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Wobei für die südeuropäischen Staaten grundsätzlich eher ein negativer Leitzins optimal wäre.
Die Taylor-Regel hat Schwächen
Die Taylor Regel, soviel ist mittlerweile klar, kommt mit solchen eklatanten Unterschieden zwischen den einzelnen Volkswirtschaften nicht zurecht. Einen anderen Lösungsansatz verfolgte der Ökonom und EZB-Ratsmitglied Athanasios Orphanides. Die von ihm modifizierte Regel vergleicht zwar ebenfalls Soll und Ist von Inflation und Wirtschaftspotenzial, basiert dabei aber im Wesentlichen auf beobachtbaren Größen. Hier liegt eine besondere Schwäche des Taylor-Ansatzes. Denn vor allem die Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten - ein zentraler Punkt der Taylor-Regel, ist nicht eindeutig messbar und wird regelmäßig im Nachhinein noch revidiert. Mit der Orphanides-Regel lässt sich das Handeln der EZB wesentlich besser erklären. Die Signale dieser Regel sind dabei eindeutig. Nach diesem Modell sind Zinserhöhungen bis auf Weiteres nicht zu erwarten.
Welche Regel nun gilt, lesen Sie auf Seite 2

Der Urlaub kann beginnen – das gilt auch für Reiseaktien